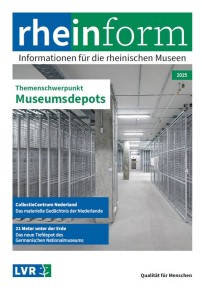Rheinländer, Deutscher, Europäer
Die neue Dauerausstellung des Adenauerhauses in Rhöndorf
-

- Bild-Großansicht
- Bild 1: Das Museumsgebäude der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus mit dem historischen Wohnhaus des ersten Bundeskanzlers im Hintergrund. (© Adenauerhaus; Fotograf: Daniel Stauch)
Dr. Jürgen Peter Schmied
Die Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus in Bad Honnef-Rhöndorf ist die älteste Politikergedenkstiftung des Bundes. Noch 1967, im Todesjahr Konrad Adenauers, übergaben dessen sieben Kinder das Wohnhaus des Gründungskanzlers, den umliegenden malerischen Garten und seinen Nachlass dem Bund, der nach dem Vorbild der amerikanischen Presidential Libraries in Rhöndorf eine Gedenkstätte und Forschungsstelle mit Archiv einrichtete.
Seitdem haben mehr als drei Millionen Gäste das original erhaltene Wohnhaus des ersten Bundeskanzlers und seinen Garten besichtigt. Ein Museum mit einer Ausstellung über Adenauers Leben und Wirken ergänzt seit 1975 das historische Ensemble (Bild 1). Nachdem die Dauerausstellung zum letzten Mal 1997 umgestaltet worden war, kann die Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus, die heute zum Geschäftsbereich der Staatsministerin für Kultur und Medien im Bundeskanzleramt gehört, nun wieder mit einer neuen, zeitgemäßen Präsentation aufwarten. Am 19. April 2017 – pünktlich zum 50. Todestag Konrad Adenauers – eröffnete Peter Altmaier, Chef des Bundeskanzleramts und Bundesminister für besondere Aufgaben, die neue Dauerausstellung der Stiftung mit dem Titel „Konrad Adenauer 1876–1967 – Rheinländer, Deutscher, Europäer“.
Das inhaltliche Konzept haben die wissenschaftlichen Mitarbeiter der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus selbst entwickelt, wobei sie während der gesamten Planungsphase von Vertretern der verschiedenen Stiftungsgremien umfangreich begleitet und unterstützt wurden. Die wissenschaftliche und ausstellungsspezifische Beratung erfolgte durch Prof. Dr. Marie-Luise Recker (Goethe-Universität Frankfurt a. M.), Prof. Dr. Hans Günter Hockerts (Ludwig-Maximilians-Universität München) und Prof. Dr. Hans Walter Hütter, Präsident des Hauses der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn.
-

- Bild-Großansicht
- Bild 2: Schiefe Stelen symbolisieren: Die Zeit und Adenauers Leben geraten 1933 aus den Fugen. (© Adenauerhaus, Rhöndorf; Fotograf: Daniel Stauch)
Mit dem Atelier Brückner hatte die Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus einen ebenso kompetenten wie professionellen Partner an seiner Seite. Das international agierende Architektenbüro, das sich mit großen Ausstellungen wie dem Rautenstrauch-Joest-Museum in Köln, dem BMW-Museum in München oder dem Parlamentarium in Brüssel einen Namen gemacht hat, widmete sich auch dem vergleichsweise „kleinen“ Projekt in Rhöndorf mit der erforderlichen Flexibilität, dem notwendigen Einfühlungsvermögen und der gewünschten Dialogbereitschaft.
Die Kosten für die Neugestaltung der Dauerausstellung des Adenauerhauses betrugen 910.000 Euro. Dass die Bundesstiftung diese Summe aufbringen konnte, verdankt sie der Staatsministerin für Kultur und Medien, dem Landschaftsverband Rheinland und der NRW-Stiftung. Die Mittel der beiden regionalen Fördereinrichtungen wurden vorrangig für eine ansprechende und attraktive Inszenierung von Adenauers Kölner Jahren und insbesondere seiner Oberbürgermeisterzeit verwendet.
Sehr frühzeitig entschied sich die Stiftung für eine chronologische Darstellung als eingängigster Zugangsweise für biografische Formate, so dass die neue Dauerausstellung nun in vier Räumen Adenauers Leben und Wirken von 1876 bis heute erzählt – von seiner Herkunft und Geburt bis zu seinem Tod, ergänzt durch eine Großvitrine für die öffentliche Erinnerung an Adenauer bis in unsere Tage. Untergliedert ist die Ausstellung in sechs Einheiten: in die Kölner Jahre der Kindheit, des beruflichen Aufstiegs und als Oberbürgermeister seiner Vaterstadt; in Adenauers Schicksal im „Dritten Reich“; in sein Wirken während der Jahre 1945 bis 1949; in die Ära seiner Kanzlerschaft 1949 bis 1963; in die letzten Lebensjahre bis 1967 und in die bereits erwähnte Vitrine für die Erinnerung an Adenauer und dessen Rezeption bis heute.
Für diese – fast könnte man sagen enzyklopädische – Sicht auf Adenauer standen lediglich 300 m² Ausstellungsfläche zur Verfügung, die bereits eine merkliche Vergrößerung im Vergleich zur alten Präsentation bedeuten. Durch die Verlegung der Caféteria in den erweiterten Empfangsbereich und die Verlagerung von Büroräumen konnte die Präsentationsfläche um gut 60 m² vergrößert und ein Multifunktionsraum hinzugewonnen werden, der für museumspädagogische Angebote, Vortragsveranstaltungen, Tagungen und Wechselausstellungen zur Verfügung steht.
Die umfassende Darstellung von Adenauers Biografie bietet vor allem zwei Vorteile. Adenauers Wirken im Rheinland, insbesondere als Oberbürgermeister der Stadt Köln, ist für die vielen Besucher der Gedenkstätte, die aus Köln und Umgebung kommen, von großem Interesse. Die Behandlung dieses Themas bietet für zahlreiche Gäste einen Anknüpfungspunkt über Adenauers historische Bedeutung als erster Bundeskanzler hinaus; der „Rheinländer“ wurde mit Bedacht in den Untertitel der Ausstellung aufgenommen.
-

- Bild-Großansicht
- Bild 4: Adenauer im VW-Käferals Großeindruck: Es geht um das Wirtschaftswunder der 1950er Jahre (© Adenauerhaus; Fotograf: Daniel Stauch)
Des Weiteren ergänzt die Ausstellung mit ihrem biografischen, ganzheitlichen Ansatz komplementär jenes Wissen, das ein Rundgang durch Adenauers original erhaltenes Wohnhaus – für viele Besucherinnen und Besucher nach wie vor die Hauptattraktion der Rhöndorfer Gedenkstätte – vermittelt. Während in Adenauers privaten Räumen vor allem seine Persönlichkeit fassbar wird und sich inhaltliche Anknüpfungspunkte lediglich für einzelne politische Themen seiner Kanzlerschaft finden, beleuchtet die Ausstellung Adenauers Politik in ihrer ganzen Breite, erstmals etwa auch sozialpolitische Maßnahmen wie die Rentenreform, die Kontinuität von nationalsozialistischen Eliten in der frühen Bundesrepublik oder die beginnende Arbeitsmigration in die Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch die damals sogenannten „Gastarbeiter“ sind ein Phänomen der Ära Adenauer.
Damit ist eine weitere wichtige Aufgabe der Ausstellungsmacher angesprochen: bei aller Konzentration auf die Biografie die Darstellung nicht zu stark auf Adenauer zu fokussieren oder gar in eine völlig unkritische „Heldenerzählung“ zu verfallen. Um solchen potentiellen Gefahren entgegenzuwirken, werden eine Reihe von Weggefährten und Zeitgenossen in biografischen Vertiefungsebenen vorgestellt, darunter der französische Staatspräsident Charles de Gaulle, der israelische Ministerpräsident David Ben-Gurion, Adenauers langjähriger Wirtschaftsminister Ludwig Erhard oder die sozialdemokratischen Politiker Kurt Schumacher und Willy Brandt. Außerdem greift die neue Dauerausstellung auch umstrittene Aspekte von Adenauers Politik auf, etwa seine enge Zusammenarbeit mit Staatssekretär Hans Globke oder sein Agieren während der Spiegel-Affäre im Herbst 1962.
-

- Bild-Großansicht
- Bild 4: Adenauers Kölner Projekte erkunden an einem multimedialen Stadtplan. (© Adenauerhaus, Rhöndorf; Fotograf: Daniel Stauch)
Die wohl größte Herausforderung bei der Konzeption der Ausstellung aber war, dass zwei – hinsichtlich Vorkenntnissen und Besuchsmotivation – ganz unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden sollten: zum einen die über Sechzigjährigen, die Adenauer noch aus eigenem Erleben kennen, zum anderen junge Leute, vor allem Schülerinnen, Schüler und Studierende, für die Adenauer und seine Kanzlerzeit eine weit zurückliegende Epoche darstellen. Um für beide Generationen eine attraktive und interessante Ausstellung zu schaffen, setzte die Stiftung in erster Linie auf die vier folgenden gestalterischen Elemente: eine inszenierte Darstellung, die neben dem Verstand auch die Emotionen anspricht 1. eine abgestufte Informationsvermittlung, die von Großeindrücken bis hin zu Schubladen, Wandklappen und Blätterbüchern reicht, 2. eine Einführung in den jeweiligen historischen Kontext, 3. sowie ein umfassendes Multimedia-Konzept mit vielen interaktiven Angeboten 4.
1.) Bereits beim Betreten der Ausstellung nimmt den Besucher eine erste Inszenierung, eine Installation Adenauers an seinem Oberbürgermeisterschreibtisch in Empfang. Besonders eindrucksvoll ist dem Atelier Brückner die Gestaltung der Einheit „Adenauer im ‚Dritten Reich‘“ gelungen. Schräge, sozusagen „schwankende“ großformatige Stelen zeigen an, dass die Zeit und Adenauers Leben aus den Fugen geraten sind und dass der einzelne in einer Diktatur den politischen Verhältnissen machtlos ausgeliefert ist (Bild 2). Dem Kanzlerraum hat das Atelier Brückner die Anmutung eines Plenarsaals gegeben und sich darüber hinaus noch einige themenspezifische Inszenierungen einfallen lassen: einen Schreibtisch für die Kanzlerdemokratie, ein Förderband für das Wirtschaftswunder, einen Verhandlungstisch für die deutsch-französische Aussöhnung.
2.) Insbesondere die bis zu sechs m² großen Fotografien im Kanzlerraum signalisieren den Besuchern auf den ersten Blick, um welche Themen es in der jeweiligen Ausstellungseinheit geht: Das Foto von Adenauer in den VW-Werken zeigt etwa die Auseinandersetzung mit seiner Wirtschaftspolitik an (Bild 3), das Foto von der Umarmung Adenauers mit Charles de Gaulle steht für die deutsch-französische Aussöhnung. Auf einer zweiten Ebene werden die Exponate und Texte präsentiert, die für das Verständnis der Themen wichtig sind. Hinter Klappen und in Schubladen verbergen sich weitere Objekte, die ein vertiefendes Wissen vermitteln und vorrangig für Besucher mit Vorwissen von Interesse sind.
3.) Die Besucher werden in die jeweiligen Zeitverhältnisse eingeführt. Das Atelier Brückner hat ein Konzept mit drei Grundfarben entwickelt, die jeweils für bestimmte Themenbereiche stehen: Auf anthrazitfarbenen Tafeln wird in die jeweiligen historischen Hintergründe eingeführt; das Privatleben Adenauers wird auf hellgrauen Wänden präsentiert; weiße Tafeln behandeln seine Karriere und das politische Wirken. Auf den fünf anthrazitfarbenen Tafeln zum Kontext der Zeit, die jeweils auch eine politische Karte aufweisen, lernen die Besucher zu Beginn der meisten Einheiten die Zeitverhältnisse kennen und erfahren zum Beispiel, dass das Rheinland früher zu Preußen gehörte und es im Köln von Adenauers Kindheit und Jugendzeit nur Pferdebahnen gab.
4.) Insgesamt 19 Medienstationen, darunter Hörstationen, selektive AV-Stationen, Großbildschirme mit historischen Filmsequenzen und Slide-Shows, machen die neue Dauerausstellung des Adenauerhauses vor allem für junge Leute attraktiv. Bereits der erste Raum enthält eine multimediale Karte von Köln, anhand der man sich ausführlich über die zahlreichen Infrastrukturmaßnahmen, die Adenauer als Oberbürgermeister seiner Vaterstadt realisiert hat, informieren kann (Bild 4). Neben Texten, historischen Fotografien und Dokumenten sowie Filmbeiträgen wird von jedem Projekt auch eine aktuelle Aufnahme gezeigt, die die langfristige Wirkung von Adenauers Regierungszeit illustriert. Über die technische Attraktivität hinaus stellt der großformatige Köln-Monitor eine weit verästelte Vertiefungseinheit dar. Besucher, die sich besonders für die Geschichte Kölns in den 1920er Jahren interessiert, könnten sich ohne weiteres 20 bis 30 Minuten mit den verschiedenen Dokumenten beschäftigen.
Schließlich setzt die Dauerausstellung auch neue Akzente durch die Auswahl der Exponate. Insgesamt haben etwa 80 Privatpersonen und Institutionen die Ausstellung mit ihren Leihgaben oder als Lizenzgeber bereichert, darunter auch Einrichtungen aus Israel, Spanien, der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika. Viele schöne Stücke stammen aber auch aus dem hauseigenen Archiv. So präsentiert die Stiftung – mit der gebotenen konservatorischen Vorsicht – jenen bunten Indianerkopfschmuck, den Adenauer 1956 in den USA im Rahmen seiner Ernennung zum „Ehrenhäuptling“ erhalten hat. Weitere Highlights sind seine Kabinettsglocke oder das Nummernschild seiner Dienstlimousine.
Gut zwei Dutzend Ausstellungsobjekte werden als Hauptexponate auf einem speziell markierten Untergrund präsentiert, darunter Adenauers Erfindungen, wie das Schrotbrot oder der elektrische Insektentöter, und eben der Indianerkopfschmuck. Sie sind vor allem für Besucher mit geringem Zeitbudget gedacht und sollen später einmal als Anlaufstationen für die Audioguide-Führungen dienen.
-

- Bild-Großansicht
- Bild 5: Kindgerecht Adenauer entdecken: mit einem Kunst-Memory und „Conny, dem Fuchs“. (© Adenauerhaus, Rhöndorf; Fotograf: Daniel Stauch)
Neben der Attraktivität der Exponate war den Ausstellungsmachern auch der Gegenwartsbezug der Präsentation und der Objekte wichtig. Die schon mehrfach erwähnte Großvitrine mit den Erinnerungsstücken an Adenauer – von einem Modell der Regierungsmaschine „Konrad Adenauer“, die die Bundeskanzler für ihre Dienstreisen nutzt, bis hin zu einem T-Shirt des Modelabels „Adenauer&Co. GmbH“ – dient nicht zuletzt dem Zweck, die Bedeutung Adenauers in der heutigen Zeit aufzuzeigen. Es sind aber auch die Zeitläufe, die Adenauer oder seiner Epoche zu einem gesteigerten Interesse verhelfen. So wird man jene berühmten „drei Kreise“, die Winston Churchill Adenauer im Mai 1953 während eines Abendessens in Downing Street No. 10 aufgezeichnet hat, um dem Bundeskanzler nahezubringen, dass Großbritannien neben den Beziehungen zum europäischen Kontinent auch noch mit dem Commonwealth und den USA auf besondere Weise verbunden sei und deshalb nicht völlig in Europa aufgehen könne, spätestens nach dem Brexit-Votum der Briten mit anderen Augen sehen. Auch Themen wie der Lastenausgleich und die Integration der Geflüchteten und Vertriebenen in der Nachkriegszeit sind von neuer Aktualität, seit Migranten und geflüchtete Menschen in steigender Zahl nach Deutschland kommen.
Sind dies Aspekte für den politisch interessierten Zeitgenossen, so hält die neue Dauerausstellung des Adenauerhauses auch für junge Besucher ein altersgemäßes Angebot bereit: zwölf Kinderstationen, auf die das Emblem mit „Conny, dem Fuchs“ hinweist (Bild 5). Er ist jeweils die Anlaufstelle für eine Quizfrage zu Adenauer, dessen Leben und Wirken so auf kindgerechte Art erkundet werden kann.
Trotz dieses ausführlichen Berichts ist bei weitem noch nicht alles über die neue Dauerausstellung gesagt. Es gibt noch Vieles vor Ort zu entdecken.
MUSEUMS-INFO
Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus
Konrad-Adenauer-Str. 8 c
53604 Bad Honnef
Tel.: 02224 921 0
Mail: info@adenauerhaus.de
Web: www.adenauerhaus.de